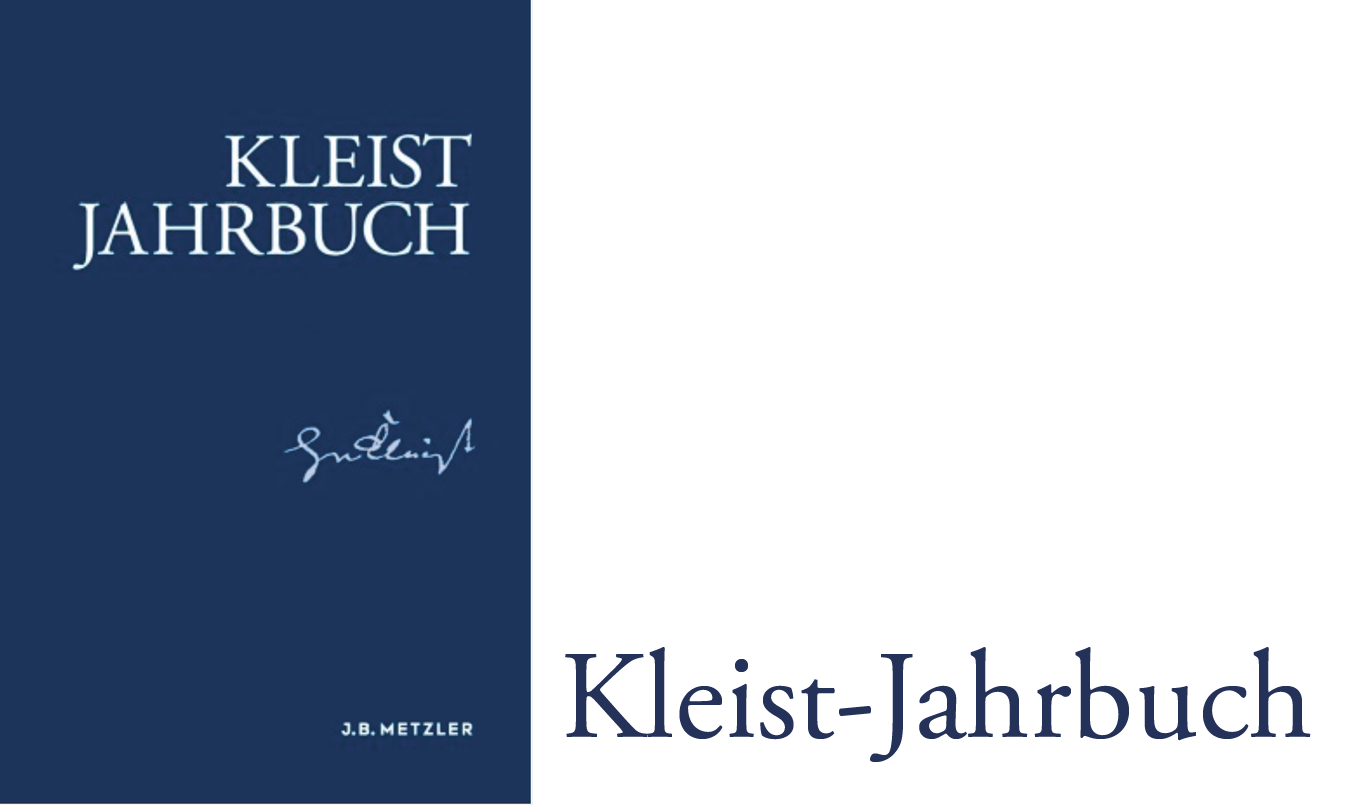
Kleist-Jahrbuch: Redaktionelles Merkblatt
Stand: – 09/2021 –
Im Auftrag des Vorstandes der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft
und des Kleist-Museums herausgegeben von Prof. Dr. Anne Fleig, Berlin, Dr. Barbara Gribnitz, Frankfurt (Oder), Prof. Dr. Christian Moser (Bonn), Anke Pätsch, Frankfurt (Oder), Dr. Adrian Robanus, Frankfurt (Oder), PD Dr. Martin Roussel, Köln
Satz: Günter Dunz-Wolff, Hamburg
Kontakt: Dr. Adrian Robanus, Kleist-Museum, Faberstraße 6-7, D-15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 0335-387221-23 , E-Mail: robanus@kleist-museum.de
A. Allgemeines
1. Überschriften: Der Beitrag sollte mit Titel und Untertitel versehen werden. Beiträge können mit römischen Ziffern und ggf. Zwischenüberschriften untergliedert werden. Bitte keine Sternchen o.ä. und keine Unter-Unter-Kapitel.
2. Abbildungen: Bitte senden Sie uns eventuelle Abbildungen separat zusammen mit den vollständigen Bildunterschriften; für die Abbildungen gilt: mindestens 300 dpi Auflösung (oder mindestens 25 × 30 cm). Für die Einhaltung der Urheberrechte trägt die Beiträgerin / der Beiträger die Verantwortung.
3. Auszeichnungen und Formatierungen
Zitate erscheinen in doppelten Anführungszeichen. Längere Zitatstücke oder mehrzeilige Verse ohne Anführungszeichen en bloc einrücken (erscheinen im Druck petit). Auslassungen werden durch Punkte in eckigen Klammern markiert. Bei direkten Zitaten werden die Fußnoten in der Regel direkt nach dem Zitat gesetzt, aber sie können in bestimmten Fällen, etwa bei Zitatreihungen, auch nach dem Komma oder Satzende platziert werden. Zitate in Zitaten werden durch einfache Anführungszeichen markiert.
Einrückungen (z.B. bei Dramenzitaten oder Spaltensatz) bitte mit der Tabulator-Taste (und nicht mit Leerzeichen) vornehmen. Bitte achten Sie auf korrekte Versumbrüche und -angaben (z.B. wenn ein Vers auf mehrere Sprecher verteilt ist).
Werktitel, Aufsatztitel sowie zitierte Kapitelüberschriften werden in einfache Anführungszeichen gesetzt, z.B. Kleists ›Penthesilea‹; auch Titel innerhalb von Zitaten werden an die Titelkonventionen des KJb angeglichen.
Hervorhebungen erscheinen im Druck kursiv. Das gilt insbesondere für Fremdwörter und Betonungen.
Eigene Ergänzungen in Zitaten: Ergänzungen, die lediglich der Satzvervollständigung oder einer unmittelbar kontextuellen Erläuterung dienen, stehen ohne Kürzel; ein Kürzel wird hinzugesetzt, wenn es sich um einen semantischen Eingriff handelt: also Hervorhebung oder eigenständige inhaltliche/ wertende Hinzufügung. Z.B.:
· »er [Kohlhaas] besaß in einem Dorfe« (DKV III, 13)
· »An den Ufern der Havel lebte […] ein Roßhändler« (DKV III, 13; Hervorhebung M.R.)
· »er besaß in einem Dorfe […] einen Meierhof [ein Bauerngehöft, in dem einmal der Verwalter (Meier) der geistlichen oder adeligen Grundherrschaft gelebt hat; A.R.]« (DKV III, 13).
Bei Hervorhebungen innerhalb von Zitaten erscheint der Hinweis auf die Hervorhebung im Anschluss an den Zitatnachweis mit Semikolon abgetrennt, z.B. (DKV III, 12; Hervorhebung A.R.).
Auslassungen innerhalb von Zitaten werden in eckigen Klammern mit Dreipunkt ›[…]‹ gekennzeichnet. Bei Auslassungen von einem einzelnen Buchstaben in Zitaten steht zwischen den eckigen Klammern ein geschütztes Leerzeichen (»Fliehend[ ]«). Das geschützte Leerzeichen wird bei Windows mit der Tastenkombination ALT + 0160 und bei MacOS durch die Tastenkombination Alt + Leertaste erzeugt. Der übliche Dreipunkt, der sonst Auslassungen markiert, ist nicht als drei einzelne Punkte zu setzen, falls das Textverarbeitungsprogramm sie nicht automatisch ersetzt. Bei Word kann der Dreipunkt durch die Tastenkombination Alt + 0133 (Windows) oder Alt + . (MacOS) erzeugt werden.
Schrägstriche werden ohne Leerzeichen gesetzt.
4. Anschrift: Bitte fügen Sie am Schluss Ihres Beitrags Ihren Namen (mit Titeln) und Ihre Anschrift in derjenigen Form an, in der sie im Mitarbeiterverzeichnis am Schluss des ›Kleist-Jahrbuchs‹ gedruckt erscheinen sollen.
B. Zitation und Nachweise
1. Siglen:
Kleists Werke werden im Fließtext nach den in das Siglenverzeichnis (s.u.) aufgenommenen Ausgaben mit Sigle und Seitenzahl zitiert. Zitate aus den Dramen werden i.d.R. mit Versangabe nachgewiesen (›DKV I, Vs. 231–234‹); Regieanweisungen unter Angabe des nachfolgenden Verses (›DKV I, vor Vs. 228‹).
BA Berliner Abendblätter, hg. von Heinrich von Kleist, Berlin 1810f. Reprint-Ausgaben, zitiert mit Angabe des Blatts bzw. der Nummer für das 1. resp. 2. Quartal und Seitenzahl; z.B.: BA, Bl. 77, 3 resp. BA, Nr. 1, 3.
BKA Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe, hg. von Roland Reuß und Peter Staengle, Basel u. Frankfurt a. M. 1988ff. Zitiert mit Abteilung/Band, Seite; z.B.: BKA II/1, 91.
BKB Brandenburger Kleist-Blätter, hg. von Roland Reuß und Peter Staengle, Berlin 1988–2010. Zitiert mit Nummer (Jahr), Seite; z.B.: BKB 15 (2003), 91.
DKV Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, 4 Bde., hg. von Ilse-Marie Barth, Klaus Müller-Salget, Stefan Ormanns und Hinrich C. Seeba, Frankfurt a. M. 1987–97. Zitiert mit Band und Seite; z.B.: DKV IV, 512.
HKB Heilbronner Kleist-Blätter. Die Kulturzeitschrift aus Heilbronn, für Alle, die etwas (Neues) zu sagen haben, hg. von Anke Tanzer und Günther Emig (H. 1–2), von Günther Emig (H. 3–4, seit H. 9), von Günther Emig und Anton Philipp Knittel (H. 5–8), Heilbronn 1996–2018. Zitiert mit Nummer (Jahr), Seite; z.B.: HKB 16 (2012), 24.
KD Kleist-Digital. Digitale Edition sämtlicher Werke und Briefe, neu ediert nach Handschriften und Erstdrucken, hg. von Günter Dunz- Wolff (erscheint seit 2012). Zitiert mit gegebenenfalls Werktitel und Fassung oder Brief- nummer sowie Vers-, Zeilen- oder Seitenzahl.
KHb Kleist-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hg. von Ingo Breuer, Stuttgart 2009; Sonderausgabe, Stuttgart 2013; z.B.: Ethel Matala de Mazza, Sozietäten (Christlich-deutsche Tischgesellschaft). In: KHb, 283–285.
KJb Kleist-Jahrbuch, hg. im Auftrag des Vorstands der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft, Erscheinungsort seit 1990 Stuttgart; vorher Berlin 1980ff.; z.B.: KJb 1998, 127–149.
LS Heinrich von Kleists Lebensspuren. Dokumente und Berichte der Zeitgenossen, hg. von Helmut Sembdner, Bremen 1957 u.ö. Zitiert mit Angabe der Dokumentennummer; z.B.: LS 462.
NR Heinrich von Kleists Nachruhm, hg. von Helmut Sembdner, Bremen 1967 u.ö. Zitiert mit Angabe der Dokumentennummer (nicht Seitenzahl); z.B.: NR 442a.
SW Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, 2 Bde., hg. von Helmut Sembdner, 9., vermehrte und revidierte Aufl., München 1993. Zitiert mit Band (römische Ziffer), Seite (arabische Ziffer), z.B.: SW9 II, 143.
Hinweise:
- Bei Zitaten aus Kleists Dramen werden auch bei der Zitation aus SW die Punkte nach den Sprechernamen weggelassen.
- Angaben aus Theaterstücken, die nicht von Kleist stammen, können nach dem Erstzitat der Ausgabe folgendermaßen im Fließtext realisiert werden: Aktzahl (römische Ziffer)/Szene (arabische Ziffer), Vs. X–Y; z.B. »This were kindness.« (I/3, Vs. 138)
2. Bibliographische Nachweise in den Anmerkungen
Allgemein:
- Originale Erscheinungsdaten können in eckigen Klammern nach dem Titel ergänzt werden.
- Doppelte Jahreszahlen werden auch zweimal ausgeschrieben. - Nach amerikanischen Städtenamen wird immer das Kürzel des Bundesstaates, mit Kommata abgetrennt, hinzugefügt. - Bei Seiten- und Versangaben, die nur die nächste Seite/den nächsten Vers inkludieren, bitte f. als Abkürzung verwenden. Bei längeren Seitenangaben bitte die exakten Seiten angeben, z.B. ›11–24‹. Mehrere Seitenzahlen werden mit Kommata abgetrennt, z.B. ›(DKV III, 480, 483, 491)‹
- Quellenangaben aus der griechischen und römischen Zeit: Bei der ersten Nennung soll bitte die verwendete Ausgabe genannt werden.
Buchtitel: Vorname(n) Name, Titel (vor Untertitel Punkt), ggf. Bde., ggf. Übersetzer, Aufl., Ort Jahr, Seitenangaben. Bei mehr als drei Autoren/Herausgebern wird nur der erste genannt, die übrigen mit ›u.a.‹ abgekürzt. Z.B.:
- László Földényi, Heinrich von Kleist. Im Netz der Wörter, aus dem Ungarischen von Akos Doma, München 1999.
- Paul Hoffmann (Hg.), Heinrich von Kleist. Die Familie Ghonorez, mit einer Nachbildung der Handschrift, Berlin 1927, S. 55.
- Olga Laskaridou und Joachim Theisen (Hg.), Nur zerrissene Bruchstücke. Kleist zum 200. Todestag. Athener Kleist-Tagung 2011, Frankfurt a.M. 2013.
- Marcel Mauss, Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften [1923/1924], aus dem Französischen von Evan Moldenhauer, Frankfurt a.M. 1990.
Forschungsbeiträge: Vorname(n) Name, Titel. In: Titel der Zeitschrift, Jahrgang (Jahr), evtl. H., Seitenangaben. Z.B.:
- Christian Begemann, Brentano und Kleist vor Friedrichs ›Mönch am Meer‹. Aspekte eines Umbruchs in der Geschichte der Wahrnehmung. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 64 (1990), S. 54–95.
- Ingo Breuer, Katarzyna Jaśtal und Paweł Zarychta, Einleitung. Heinrich von Kleist und die Briefkultur um 1800. In: Dies. (Hg.), Gesprächsspiele & Ideenmagazine. Heinrich von Kleist und die Briefkultur um 1800, Köln, Weimar und Wien 2013, S. 11–26.
- Joachim Bumke, Der inszenierte Tod. Anmerkungen zu ›Prinz Friedrich von Homburg‹. In: KJb 2011, 91–109, hier 97, Anm. 15.
- Clemens Heselhaus, Das Kleistsche Paradox. In: Helmut Sembdner (Hg.), Kleists Aufsatz ›Über das Marionettentheater‹. Studien und Interpretationen, Berlin 1967, S. 112–131.
- Friedrich A. Kittler, Ein Erdbeben in Chili und Preußen. In: David E. Wellbery (Hg.), Positionen der Literaturwissenschaft. Acht Modellanalysen am Beispiel von Kleists ›Das Erdbeben in Chili‹, 3. Aufl., München 1993, S. 24–38, hier S. 36–38.
- Gabriele Brandstetter, »Eine Tragödie von der Brust heruntergehustet«. Darstellungen von Katharsis in Kleists ›Penthesilea‹. In: Tim Mehigan (Hg.), Heinrich von Kleist und die Aufklärung, Rochester, NY, 2000, S. 186–210.
- Heinz Dieter Kittsteiner, Der Streit um Christian Jacob Kraus in den ›Berliner Abendblättern‹, http://www.textkritik.de/vigoni/kittsteiner1.htm (29.12.2015).
Die ›Beiträge zur Kleist-Forschung‹ und ›Gedankenstriche‹ werden ohne Jahrgang zitiert, da die Jahre nicht durchlaufend sind:
- Scholz, Kai-Uwe: »Deshalb machte ich von meinem Führerrecht Gebrauch, ganz allein zu bestimmen.« Georg Minde-Pouet und die Kleist-Gesellschaft 1934–1945. In: Beiträge zur Kleist-Forschung 1996, S. 86–101.
Quellen aus Gesamtausgaben: Nachgewiesen wird i.d.R. der jeweils verwendete Einzelband: Vorname(n) Name, Titel (vor Untertitel Punkt). In: Ders./Dies., Titel der Gesamtausgabe, Bd., Hg., ggf. Übersetzer, Aufl., Ort Jahr, Seitenangaben (Von-Bis-Angaben nur bei nicht selbständigen Texten). Bei mehr als drei Autoren/Herausgebern wird nur der erste genannt, die übrigen mit ›u.a.‹ abgekürzt. Z.B.:
- Johann Wolfgang von Goethe, Die Wahlverwandtschaften. In: Ders., Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche, Bd. 8, hg. von Waltraud Wiethölter, Frankfurt a.M. 1997, S. 269–530, hier S. 515.
- Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten. In: Ders., Werkausgabe in zwölf Bänden, Bd. 8, hg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt a.M. 1977, S. 309–634, hier S. 487.
- Friedrich Schiller, Wallenstein. In: Ders., Werke und Briefe, Bd. 4, hg. von Frithjof Stock, Frankfurt a.M. 2000.
Rückverweise: Statt mit ›a.a.O.‹ oder ›loc.cit.‹ wird direkt auf die Anmerkung verwiesen, in der das Werk zum ersten Mal bibliographisch vollständig aufgeführt ist: ›Nachname, Haupttitel (wie Anm. 13), S. 34–42‹. Bei der Zitation verschiedener Beiträge desselben Bandes wird auf die Anmerkung mit dessen erster Anführung verwiesen. Die Abkürzung ›ebd.‹ wird nicht verwendet.
- Begemann, Brentano und Kleist vor Friedrichs ›Mönch am Meer‹ (wie Anm. 4), S. 54, 86, 93.
- Heselhaus, Das Kleistsche Paradox (wie Anm. 12), S. 120.
- Klaus Müller-Salget, Probleme der Edition und der Kommentierung von Kleists Briefen. In: Breuer, Jaśtal und Zarychta (Hg.), Gesprächsspiele & Ideenmagazine (wie Anm. 1), S. 55–68, hier S. 64.
- Goethe, Die Wahlverwandtschaften (wie Anm. 32), S. 517.
- Johann Wolfgang von Goethe, Die Leiden des jungen Werthers. In: Ders., Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche, Bd. 8 (wie Anm. 32), S. 16.
Zeitungen: Vorname(n) Name, Titel. In: Titel der Zeitung, Datum im Format XX.YY.ZZZZ, ggf. Seitenangabe. Online-Beiträge aus Zeitungen werden wie Internetdokumente zitiert.
- Hermann Kurzke, Heinrich von Kleists Krankheit und Größe. In: Die Welt, 28.10.2007, https://www.welt.de/ kultur/article1298052/Heinrich-von-Kleists-Krankheit-und-Groesse.html (25.08.2021).
In der Regel werden ausschließlich runde Klammern verwendet. Binnenklammern werden nach Möglichkeit aufgelöst; eckige Klammern stehen bei verdeutlichenden oder hervorhebenden Einfügungen.
- »Wenn man weiter bedenkt, wie früh er [Kleist] Vater und Mutter verlor und das Elternhaus durch eine Kaserne ersetzt sah, dann wird man das Gefühl nicht los, dass da ein Traumatisierter durch den Kontinent und durch sein Leben irrt […].« (Bärfuss, Der Ort der Dichtung, wie Anm. 1, S. 117f.)
Abkürzungen: Folgende Abkürzungen werden (gegebenenfalls nur in Fußnoten) verwendet: ›Anm.‹ (Anmerkung), ›Aufl.‹ (Auflage), ›Bd./Bde.‹ (Band/Bände), ›bzw.‹ (beziehungsweise), ›ca.‹ (circa), ›etc.‹ (et cetera), ›H.‹ (Heft), ›Hg./hg.‹ (Herausgeber/herausgegeben), ›Nr.‹ (Nummer), ›o.ä.‹ (oder ähnlich), ›u.a.‹ (unter anderem), ›usw.‹ (und so weiter), ›Vgl.‹ (Vergleiche; statt ›Cf.‹), ›vs.‹ (versus), ›zit. nach‹ (zitiert nach).
Abkürzungen und Schreibweisen von Ortsnamen: ›Frankfurt a.M.‹ (Frankfurt am Main), Freiburg i.Br. (Freiburg im Breisgau), Frankfurt (Oder).
